Hörneraltäre werden Ende des 4. Jh. -
Anfang des 3. Jh. v. Chr. von den Griechen nach
Ägypten importiert. Ihr Ursprung liegt im
hellenistisch-syrischen Raum.
Charakteristisch sind Rundstab, Hohlkehle und die
auf den vier Ecken des Altars stehenden Tetraeder.
Der früheste nachgewiesene Hörneraltar findet sich
vor dem Grab des Petosiris in Tuna el-Gebel. Er ist
aus Kalkstein und hat eine imposante Höhe von 2,60 m. |
 |
|
 |
|
Hörneraltar vor
dem Grab des Petosiris
Foto:
Haremhab |
Zeichnung
des Hörneraltares vor dem Grab des Petosiris
aus Soukiassian, BIFAO 83, S. 321, fig. 1 |
|
In Luxor befinden sich zwei
Hörneraltäre, genauer in Karnak. Einer steht im Hof des Ipet-Tempels, ein
anderer im nord-östlichen Bereich hinter dem Achmenu. |
|
 |
Der aus Kalkstein bestehende
Hörneraltar findet sich östlich der Nordkapelle von
Nektanebos I. Er bildet mit dem südöstlich von ihm
liegenden Opferplatz eine Einheit.
Mit Rundstab, Hohlkehle und Tetraeder
weist der Altar die charakteristischen Merkmale
seiner Gattung auf.
Plan aus: Ernst, Tf. 190 -
nachträglich beschriftet.
Foto: Iufaa |
 |
|
 |
Der Altar ist, bis auf eine
fünfzeilige Huldigungsinschrift auf der äußeren
Ostwand des Treppenaufganges, inschriftenlos. Eine
Datierung über Inschriften ist somit nicht gegeben.
Der Altar ist über eine Treppe von
Norden her zu erreichen. Der Priester gelangte so
auf einen Podest unterhalb der Hohlkehle des Altares
von dem aus er die Kulthandlung vornehmen konnte.
Die Treppe war mit Seitenmauern versehen, deren
Abschluss wiederum eine Hohlkehle war. |
|
Foto: monja |
|
|
 |
 |
|
Fotos: Iufaa |
|
Der Zugang konnte verschlossen werden.
Davon zeugt die Türkammer rechts und links des
Einganges (Bild unten links) und das Loch zur
Türeinhängung (Bild unten rechts). Zwei
Riegellöcher sind an der östlichen Innenwand
ebenfalls vorhanden. Unter dem Staub von Karnak wird
wohl die Türeinschubrille verborgen sein. |
|
 |
 |
|
Fotos: monja |
|
 |
|
Foto: monja |
|
Die Altaroberfläche ist rau. Je
zwei Tetraeder sind aus einem Stein gearbeitet. Die
Mittellage ist aus drei kleineren Steinen
zusammengesetzt.
Hörneraltäre dienten wohl generell einem Brandopfer.
Bei einer rauen Oberfläche des Altares wird dessen
Reinigung erschwert. Direktes Feuer schadet auf
Dauer dem Stein. So muss man sich wohl ein
Metallbecken auf dem Altar stehend ergänzen, oder
ähnliches. Für eine Metallabdeckung der
Altaroberfläche fehlen notwendige Dübellöcher. |
|
 |
Der Altar hat vom Sockel gemessen eine
Höhe von 2,40 m. Seine Breite beträgt 1,80 m im
Quadrat. Der Altarkörper enthält im Westen eine kleine
Kammer, deren Boden heute fehlt. |
|
 |
|
Foto: monja |
Foto: monja |
|
Die Höhe des Bodens und Reste einer
Einschubrille für eine einflügelige Tür sind
deutlich zu erkennen. Auch eine
Verschlussmöglichkeit war vorhanden. Im Verhältnis
von Breite der Tür und Tiefe der Nische blieb nicht
viel Abstellfläche im hinteren Teil der Nische
übrig. |
|
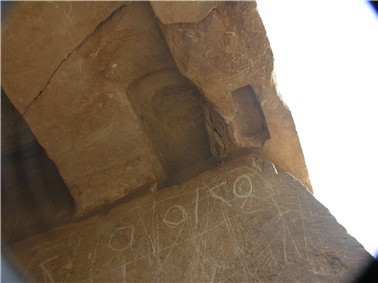 |
 |
|
Foto: monja |
Foto: monja |
|
 |
|
Plan, Detail aus:
Ernst, Tf. 190 |
Im Fünf-Meter-Bereich südöstlich des Altars befindet sich ein
Opferplatz (siehe Steinplan oben).
Die, heute nicht mehr sichtbaren, Grabungsbefunde
erlauben scheinbar die Rekonstruktion eines kleinen
Tisches bzw. Altares mit Rundstab und Hohlkehle.
Dieser war ca. 58 cm hoch und maß 1,23 x 0,53 m.
Ernst (S. 197) beschreibt den Platz im folgenden:
Südwestlich des Tisches war ein wenig eingetieftes
quadratisches Bassin von 1,60 , Seitenlänge. Es hat
im Westen eine Rinne, die in ein kleines Bassin
(0,40 m x 0,32 m) von ca. 0,15 m Tiefe mündet.
Dieser Befund ist als Schlachtplatz zu deuten. Der
längliche Tisch diente zum Auflegen der
zerstückelten Opfertiere, bevor sie auf den
Hörneraltar als Opfer gelegt wurden. Das 1,60 m im
Quadrat messende wenig eingetiefte Bassin wurde zum
Zerlegen der Tiere benutzt, wobei das Blut in dem
kleinen Becken, das westlich vor dem großen Bassin
lag, aufgefangen wurde. |
|
 |
|
Altar mit Stelle
des Opferplatzes
Foto: monja |
Ein ähnlicher Befund liegt im Hof des
Ipet-Tempels in Karnak vor.
|
|
Literatur: |
|
LÄ I Sp. 148 - Altar |
|
Herbert Ernst: Die Altäre in den Opferhöfen der
Tempel. Diss. 1998 microfichepubl. |
|
Georges Soukiassian:
Les autels "à cornes" ou "à acrotères" en Égypte.
BIFAO 83/1983 S. 317-333 |
|
|
|
Eingestellt durch:
naunakhte |
|
Bearbeitet am:
12.06.2008
|